Heute schauen wir mit unserer Kräuterfrau und Schwarzwald-Guide Monika Wurft auf ein kleines Rosengewächs mit viel Wurzelpower. Obwohl sich die Blutwurz in der Natur derzeit noch bedeckt hält, gehört sie unbedingt zum festen Bestandteil einer Hausapotheke.
Daran erkennt ihr die Blutwurz
Für eine große Heilpflanze kommt die Blutwurz zumindest oberirdisch recht klein und unscheinbar daher. In der Blütezeit von Mai bis in den September, wenn sie sich mit zarten, gelben und einen Zentimeter großen Blüten schmückt, könnt ihr sie daran sehr gut erkennen. Zuvor müsst ihr schon genau hinschauen, um die am Boden kriechende Pflanze in einer Wiese überhaupt zu entdecken. Die Blutwurz bevorzugt dazu noch magere, mäßig saure Böden und kommt in lockeren Beständen auf Wiesen, in Laub-, Misch- und Nadelwäldern an Weg- und Waldrändern, an Böschungen und auf Waldlichtungen vor. Auch als Aufrechtes Fingerkraut bekannt, gehört die Blutwurz zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Durch ihren botanischen Namen „Potentilla erecta“ kommt man der sich zum Licht reckenden Kraftpflanze schon näher.


Erkennungsmerkmal: vier Blütenblätter
Aus einem knollig verdickten Wurzelstock wachsen ihre gegabelten Stängel zunächst niederliegend, zur Blütezeit jedoch richten sie sich bis zu einer Höhe von 30 bis 40 Zentimetern auf. Ihre am Stängel sitzenden gezähnten Blätter erinnern an die fünf Finger einer Hand. Genaugenommen setzen sie sich aus einem dreigeteilten Blatt und in der Regel zwei kleineren Nebenblättern zusammen, sodass die Blätter fünfzählig erscheinen. Die Nebenblätter sind ein besonderes Merkmal der Rosengewächse und durch ihr damit verbundenes Erscheinungsbild wird die Blutwurz immer wieder mit anderen Fingerkräutern aus der Familie der Rosengewächse verwechselt.
Dabei macht es uns die Blutwurz bei genauer Betrachtung in der Bestimmung ganz leicht. Ihre Blüten, die lang gestielt und einzeln in den Blattachseln stehen, setzen sich aus vier gelben Blütenblättern zusammen. Sie unterscheiden sich dadurch deutlich erkennbar von ihren nahen Verwandten wie dem Rötlichen Fingerkraut, dem Frühlings-Fingerkraut oder dem Kriechenden Fingerkraut, deren Blüten allesamt aus fünf gelben Blütenblättern bestehen.


Mathematik in der Natur
Die Blutwurz präsentiert sich damit mit einer botanischen Besonderheit innerhalb der Familie der Rosengewächse. Die Blüten aller weiteren Rosengewächse wie zum Beispiel Hagebutte, Apfel oder Birne setzten sich darüber hinaus aus einem Vielfachen von fünf Blütenblättern zusammen. Übrigens: Auch bei der Edelrose im Geburtstagsstrauß lässt sich die Anzahl der Blütenblätter durch fünf teilen. Doch dies solltet ihr erst beim Verwelken durch Auszupfen überprüfen, sonst gibt es womöglich Ärger!
Blutwurz und ihre inneren Werte
Zurück zu „Potentilla erecta“, der vor Kraft strotzenden Blutwurz, die mit weiteren Namen wie Ruhrwurz, Bauchwehwurz, Roter Heilwurz, aber auch Tormentill und Rotwurz auf ihre inneren Werte als Heilpflanze aufmerksam macht. Der Name Blutwurz ist dabei Programm. Es wird die „Wurz“ im Sinne von Wurzel verwendet und „Blut“ bezieht sich auf den roten Farbstoff, das sogenannte Tormentillrot in ihr. Dieser wird sichtbar, sobald die Wurzel angeschnitten wird. Zunächst ist die Schnittstelle weiß, dann zeigt sich eine intensive Rotfärbung. Neben diesem roten, antibakteriell wirkenden Farbstoff enthält sie als weitere sekundäre Inhaltsstoffe Gerbstoffe, Flavonoide, ätherische Öle und Harze.
Für Heilzwecke in der Volksheilkunde wird der unterirdische Wurzelstock der Blutwurz seit dem Altertum verwendet, da sie als ausgezeichnete Gerbstoffdroge zusammenziehend und blutstillend wirkt. Deshalb kommt sie als Gurgelmittel bei Halsschmerzen, Zahnfleischentzündungen und Mandelentzündungen zum Einsatz. Eine Abkochung der Wurzel ist hilfreich bei schlecht heilenden Wunden, Hautausschlägen, Verbrennungen, Hämorrhoiden und Herpes. Innerlich wird die Blutwurz bei Magen- und Darmstörungen, besonders bei Durchfällen, eingesetzt. Als sinnvoller Begleiter in der Hausapotheke kommt die Blutwurz in Form von Tinktur, Schnaps oder als Tee aus getrockneten Wurzelstücken zur Verwendung. Aufgrund des hohen Gerbstoffgehalts ist Blutwurz-Tee für Kinder unter zwölf Jahren und in Schwangerschaft und Stillzeit allerdings nicht zu empfehlen.

Ernte- und Gartentipp
Die Haupterntezeit der Wurzel ist im zeitigen Frühjahr und dann wieder im Herbst, wenn die Pflanzen oberirdisch eingezogen sind und ihre Inhaltsstoffe in ihren Speicherorganen gesammelt haben. Um auf die Wurzelstöcke zurückgreifen zu können, muss man folglich die Standorte kennen.
Wer sich in dieser Jahreszeit einen Vorrat zulegen will, deckt sich am besten mit getrockneten Wurzelstücken aus der Apotheke ein. Um die Wildbestände zu schonen, könnt ihr die Blutwurz auch im eigenen Garten ansiedeln. In gut sortierten Kräutergärtnereien gibt es Topfpflanzen zu kaufen, die ihr in einer mageren Wiese oder im Steingarten auspflanzen könnt. Schwere lehmige oder kalkhaltige Gartenböden und handelsübliche Blumenerden sind für die Kultivierung der Blutwurz nicht zu empfehlen. Auch bei der Ernte im eigenen Garten solltet ihr immer darauf achten werden, dass ein Teil des Wurzelstocks im Boden bleibt, damit die Pflanze an diesem Standort nicht verloren geht.
Blutwurz-Tee
Dazu wird ein Teelöffel kleingeschnittene Blutwurz-Wurzel mit 150 ml kochenden Wasser übergossen. Diesen Sud hält man zehn Minuten lang am Köcheln, gießt dann ab und trinkt den Tee bei Durchfallerkrankungen noch warm in kleinen Schlucken. Zum Gurgeln bei Halsentzündungen ist dieser Tee ebenfalls sehr hilfreich. Empfehlenswert sind dabei auch Teemischungen mit Salbei und Kamille.
Blutwurz-Tinktur
Zur Tinkturherstellung werden die gewaschenen Wurzeln in kleine Stücke geschnitten und ein Schraubdeckelglas gut damit befüllt. Man übergießt sie mit 38-prozentigem Doppelkorn und lässt das Ganze vier bis sechs Wochen stehen, wobei das Glas öfter mal geschüttelt werden sollte. Danach wird die inzwischen tief dunkelrote Tinktur abgegossen und zur tropfenweisen Dosierung am besten in kleine Pipettenfläschchen gefüllt.

Diese Tinktur ist innerlich wie äußerlich wirksam. Zum innerlichen Gebrauch bei Durchfällen werden, verdünnt in Wasser oder Tee, drei- bis fünfmal täglich 20 bis 30 Tropfen verabreicht. Äußerlich ist sie bei kleineren Hautverletzungen, Schnittwunden, Schrunden aber auch bei Fußpilz wirksam.
Tipp: Durch ihr breites Wirkungsspektrum ist die Blutwurz Tinktur ein idealer Begleiter in der Reiseapotheke.
Blutwurz-Salbe
Als weitere Zubereitungsart bietet sich eine Salbe mit Blutwurz an. Dazu werden 20 Gramm kleingeschnittene Wurzelstücke zuerst in etwas Alkohol eingelegt, damit die Gerbstoffe herausgelöst werden. Dieser Auszug wird zusammen mit 200 Millilitern Sonnenblumen- oder Olivenöl rund 30 Minuten auf 70 °C erhitzt. Nach dem Abseihen der Wurzelstücke löst man in diesem Öl etwa 30 g Bienenwachs auf, damit die Salbe streichfähig wird. Noch warm wird die Salbe in kleine Salbendöschen abgefüllt, die nach dem Abkühlen verschlossen, kühl und dunkel aufbewahrt werden. Wirksam sind auch Kombinationen von Blutwurz mit Ringelblumen- oder Gänseblümchenblüten. Die Blutwurz-Salbe ist bei rissiger Haut, Schrunden, spröden Lippen, kleineren Wunden und Hautunreinheiten empfehlenswert.
Blutwurz-Schnaps
Am bekanntesten ist mit Sicherheit der verdauungsfördernde Blutwurz-Schnaps. Dieser ist im Schwarzwald und im Bayrischen Wald zu einem deftigen Vesper auf jeder Speisekarte zu finden. Hierzu wird traditionell ein aus Topinambur gebrannter Schnaps mit Blutwurz angesetzt. Verwendet werden zirka 60 Gramm feingeschnittene Wurzelstücke auf einen Liter Schnaps. Nach zwei bis drei Wochen hat sich der Schnaps rötlich verfärbt und die Gerbstoffe geben ihm seine besondere herbe Geschmacksnote. Dann wird er abgeseiht und zum Nachreifen noch einige Zeit stehen gelassen. Auf dieser Basis kann man mit 150 Gramm Kandiszucker, etwas Zimt, Sternanis, Nelke und Kardamom auch einen Blutwurz-Likör ansetzen.
Mehr Kräuterwissen gibt’s im Buch von Monika Wurft:
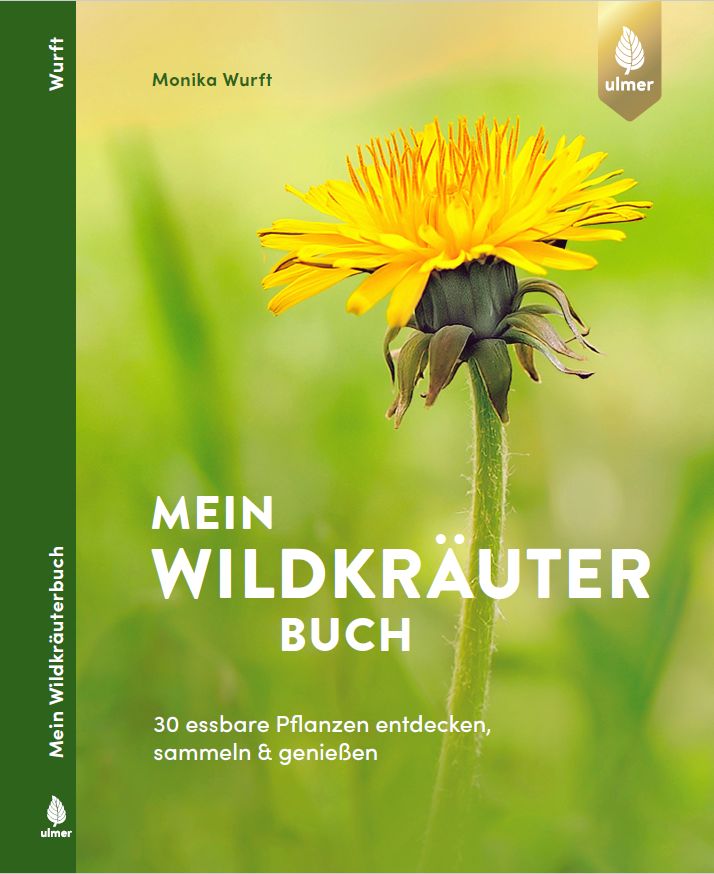


Monika Wurft, Mein Wildkräuterbuch, 2. Auflage März 2020 Ulmer-ISBN: 978-3-8186-1123-1
(Text und Fotos: Monika Wurft)
2.3.2023









 Jetzt Shoppen!
Jetzt Shoppen!