Hauptursache für massenweises Bienensterben ist die zerstörerische Varroamilbe. Dieser Parasit ist perfekt an den Lebenszyklus der Biene angepasst, sodass die Bienen selbst kaum mit der Plage fertig werden können. Daher ist diese Milbe der wohl schlimmste Feind unserer heimischen Honigbiene und muss durch die Hilfe des Imkers bekämpft werden. Die Winterbehandlung gegen Varroa ist unumgänglich, damit das Bienenvolk nach der kalten Jahreszeit stark und vital in den Frühling starten kann. Davon hängt auch maßgeblich ab, ob und wieviel Honigertrag der Imker in der nächsten Saison erwarten kann. Unser Partner, die Imkerei Cum Natura aus dem Schwarzwald, hat die wichtigsten Fakten rund um die gefährliche Varroamilbe und die Winterbehandlung gegen diese zusammengefasst.
Ohne Imker keine Bienen
Die Varroamilbe stammt ursprünglich aus Südostasien. In den 70er Jahren wurde sie nach Deutschland eingeschleppt und richtet seither immer wieder verheerenden Schaden bei den einheimischen Honigbienen an. Die östliche Honigbiene hat im Gegensatz zur westlichen mit der Zeit Abwehrmechanismen gegen die Varroamilben entwickelt. Deshalb verursacht der Parasit bei der östlichen Bienenart deutlich geringere Schäden. Ein westliches Bienenvolk hat bei längerem Befall kaum Überlebenschancen. Was im Umkehrschluss bedeutet: Ohne Imker und die lebensrettende Behandlung gegen Varroa gäbe es unsere heimische Honigbiene wohl bald nicht mehr.

Wie schadet die Varroamilbe den Honigbienen?
Varroamilben sind in allen Entwicklungsstadien parasitisch und perfekt an den Entwicklungszyklus der Bienen angepasst. So kommt diese Milbe nur innerhalb des Bienenstocks oder festgesaugt auf einzelnen Bienen vor. Die Milbe ernährt sich vorwiegend vom Fettgewebe der Bienen, indem sie sich an diesen festklammert und sie aussaugt. Besonders verheerend hierbei ist, dass die Varroamilbe sowohl erwachsene Bienen als auch Brutzellen befällt und sich somit auch von Bienenlarven ernährt. Die Larven werden dadurch bereits vor dem Schlüpfen stark geschwächt und können unter Umständen sogar Fehlbildungen entwickeln. Auch erwachsene Honigbienen leiden sehr unter den
Milben. Ihr Immunsystem wird durch das Aussaugen durch die Milben nachweislich beeinträchtigt, wodurch sie deutlich anfälliger für Viren sind.
Vermehrung in den Brutzellen der Bienen
Die Vermehrung der Varroamilben kann ausschließlich innerhalb der Brutzellen erfolgen. Weibliche Milben krabbeln hierzu von ihrer Wirtsbiene in eine Brutzelle, die kurz vor der Verdeckelung steht. Das bedeutet, dass sich im Inneren der Zelle bereits eine Bienenlarve aus einem Ei der Königin entwickelt hat. Nachdem die Brutzelle von den Bienen verdeckelt wurde, legt die Milbe ihr erstes unbefruchtetes Ei. Daraus entwickelt sich eine männliche Milbe. Nach dem ersten Ei legt die Muttermilbe weitere Eier, diese sind befruchtet und bilden sich zu Weibchen aus. Die Paarung findet
anschließend noch innerhalb der Zelle unter den Geschwistermilben statt, da die männliche Milbe außerhalb nicht überleben kann.

Infektion bei der Begegnung von Bienenvölkern
Während dieser Zeit dient die Bienenlarve den Varroamilben als Nahrungsquelle. Sobald sich die Larve zu einer Biene ausgebildet hat und schlüpft, stirbt das Milbenmännchen. Die begatteten weiblichen Varroamilben verlassen zusammen mit der Muttermilbe auf der schlüpfenden Biene die Zelle und der Zyklus beginnt von Neuem. Außerhalb des Bienenstocks verbreitet sich die Varroamilbe, indem sie durch ihre Wirtsbiene mit Bienen anderer Völker in Kontakt kommt. Diese Verbreitung ist jedoch eher selten, meist erfolgt eine Infektion, indem ein schwaches, von der Milbe befallenes Volk, von einem starken gesunden Bienenvolk ausgeräubert wird. Hierbei können die Varroamilben das Wirtstier wechseln und infizieren somit das nächste Volk. Ein weiterer Weg für die Verbreitung des Parasiten stellt der
Handel mit Bienenvölkern dar, da diese beim Kauf häufig bereits mit Varroa infiziert sind. Aus diesem Grund sollten neue Völker zunächst auf Krankheiten hin untersucht werden und möglichst abseits von anderen Stöcken stehen.
Wann muss die Imkerei handeln?
Typische Symptome für einen Befall von Varroamilben sind kleine rotbraune Punkte, die auf Bienenlarven oder erwachsenen Bienen zu sehen sind, aber auch Missbildungen bei frisch geschlüpften Bienen. Um den Varroamilbenbefall einschätzen zu können, führt Imkermeister Stefan Kumm eine so genannte Gemülldiagnose durch. Hierzu werden die Milben gezählt, die von den Bienen abfallen und sich auf dem Bodenschieber ansammeln, der in den Boden der Beute geschoben wird. Sind auf dem Schieber mehr als vier der braunen rundlichen Parasiten zu sehen, sollte man möglichst bald eingreifen. Diese Methode eignet sich zur Kontrolle im Winter besonders gut, da die sich die Bienen zu dieser Zeit zur Wintertraube zusammenhäufen und sich die Untersuchung der einzelnen Waben nicht anbietet. Wobei eine Behandlung im Winter immer zu empfehlen ist, da es nahezu unmöglich ist, ein Volk dauerhaft komplett frei von Varroamilben zu halten.
Oxalsäure als effektives Mittel gegen die Varroamilbe
Im Winter nutzt Imkermeister Stefan Kumm Oxalsäure, um die Varroamilbe zu bekämpfen. Diese
Säure ist ein zugelassenes Mittel im Kampf gegen die Parasiten, welches bei richtiger Anwendung den Bienen selbst nicht schadet. Bei der Behandlung träufelt er die Säurelösung vorsichtig in die besetzten Wabengassen. Durch den ausgeprägten Putztrieb der Bienen verteilen sie die Säure anschließend im gesamten Stock. Die Milben fallen bei Kontakt mit der Oxalsäure von den Bienen ab und sammeln sich auf dem Bodenschieber. Nach der Behandlung lässt sich anhand der Anzahl der abgefallenen Milben auf dem Schieber einschätzen, ob die Behandlung erfolgreich war.
Timing ist alles
Wichtig zu beachten ist hierbei, dass die Winterbehandlung gegen Varroamilben am effektivsten anschlagen kann, wenn sich im Bienenstock keine verdeckelte Brut mehr befindet. Sonst können die Milben innerhalb der Brutzellen nicht von der Säure erreicht werden. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass die Bienenkönigin mit Eintreten des ersten Frostes keine Eier mehr legt und dementsprechend keine neue Brut herangezogen wird. 21 Tage später befindet sich dann keine verdeckelte Brut mehr im Bienenvolk. Die immer milder werdenden Winter stellen ebenfalls ein großes Problem für die Imker dar, da brutfreie Zeiten im Winter somit nicht immer gewährleistet sind und die Behandlung gegen Varroamilben somit nicht so wirksam sein kann.
Nur gesunde Völker produzieren das flüssige Gold
Die Relevanz der Behandlung gegen Varroamilben für das Fortbestehen der Honigbienen ist somit essenziell. Ohne das helfende Zutun der Imker hätten die heimischen Bienen kaum eine Chance gegen den eingeschleppten Parasiten. Wer ein gesundes Bienenvolk möchte, das auch fleißig Honig produziert, muss sich demnach, immer zum Wohle der Tiere, mit dieser Thematik auseinandersetzen und seine Bienen vor der zerstörerischen parasitären Bedrohung schützen. Die Behandlung gegen Varroamilben lohnt sich auf jeden Fall. Ein gesundes Bienenvolk kann bis zu 30 Kilogramm Honig im Jahr produzieren! Die Sorten sind hierbei individuell abhängig von Standort und Umfeld der Bienenstöcke. Die Geschmacksvielfalt reicht von lieblichem Sommerblütenhonig bis hin zu kräftigen aromatischen Sorten wie Edelkastanienhonig oder Weißtannenhonig, vielseitig einsetzbar, beispielsweise zum Süßen von Heißgetränken oder Backen. Die Imkerei Cum Natura hat passend hierzu eine tolle Auswahl leckerer Rezepte mit Honig zum Nachmachen. Für all diejenigen, die am liebsten direkt mitkochen oder backen, ohne viel Text lesen zu müssen, gibt es auch einige Kochvideos auf dem Imkergut-YouTube-Kanal.
Neben Honig produziert ein Bienenvolk aber auch einige andere wertvolle natürliche Rohstoffe, wie zum Beispiel Propolis, eine harzartige Substanz, der man unter anderem eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung nachsagt. Mehr über dieses Wundermittel der Natur und die weiteren wertvollen Rohstoffe, die sich mithilfe von Bienen gewinnen lassen, findet Ihr auf der Website der Imkerei Cum Natura.
(Fotos: David Mark, rostichep, olivierlevoux, xiSerge [alle pixabay.com], Cum Natura; Video: Cum Natura)
3.1.2022













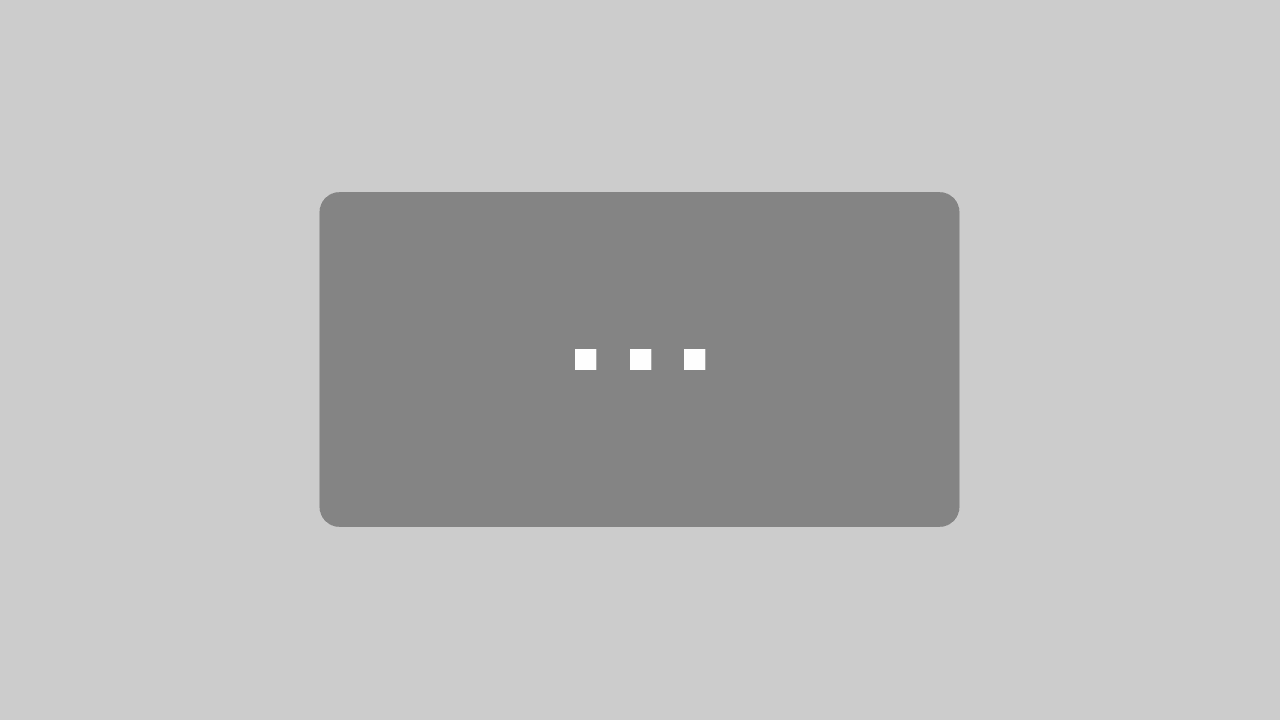

 Jetzt Shoppen!
Jetzt Shoppen!