Heute schauen wir mit unserer Kräuterfrau und Schwarzwald-Guide Monika Wurft einige essbare Doldenblütler an. Von Wilder Möhre bis Giersch zur Blütezeit sehen sich die Doldenblütler verflixt ähnlich. Da hilft nur ein bisschen zu botanisieren, denn bei genauerem Betrachten kann man sie doch unterscheiden.
Wenn es um Wildkräuter geht, treibt die Familie der Doldenblütler, die Apiaceae, viele in die Verzweiflung, da sie rein an ihren Blütenständen sehr schwer zu unterscheiden sind. Zum einen changiert ihre Blütenfarbe nur von Cremeweiß bis ins Gelbliche und zum anderen sind ihre tellerförmigen Dolden vom Blütenaufbau alle gleich.

Geht euch das auch so? Da hilft nur eins – ein schneller Blick reicht bei den Doldenblütlern nicht aus, man muss genauer hinschauen, damit sich die Unterschiede auftun. Erfreulicherweise gibt es außer den Blütenständen noch weitere Pflanzenteile, die zur Bestimmung beitragen: die Stängel, Blätter, Früchte und nicht zuletzt die Wurzeln.
Wissenswertes über Doldenblütler
Doldenblütler repräsentieren eine sehr große Familie, die mit ihren ätherischen Ölen als Würzpflanzen wie Kümmel, Anis, Koriander, Dill, Petersilie, Liebstöckel und darüber hinaus als schmackhafte Gemüsepflanzen wie Sellerie, Fenchel, Möhre und Pastinake in jeder Küche zum Einsatz kommen. Bei den Wildkräutern, die ebenfalls prima als Wildgemüse und Würzkräuter verwendet werden können, trifft man auf Giersch, Bärwurz, Wiesen-Bärenklau, Engelwurz und Wilde Möhre, um nur einige zu nennen. Berühmt-berüchtigt ist diese Familie jedoch durch ihre giftigen Vertreter wie Gefleckter Schierling, Hundspetersilie und Wasserfenchel.
Daraus resultiert auch der große Respekt vor den Doldenblütlern in der freien Wildbahn, doch das sollte euch nicht vor dem Umgang mit ihnen zurückschrecken, sondern dazu animieren, genauer hinzuschauen, um sie zu unterscheiden.

Daran könnt ihr Doldenblütler unterscheiden
Ihre Blütenstände werden als Doppeldolden bezeichnet, da sie sich aus vielen kleinen Döldchen zusammensetzen. Früher hießen sie Schirmblütler (Umbelliferae), und das aus gutem Grund. Wie bei einem Schirm beginnt die Verästelung der Dolde an einem gemeinsamen Punkt und die Verästelungen der kleinen Döldchen ebenfalls. Für uns eine kleine Eselsbrücke, denn durch diese Symmetrie wirken die Blütenstände wie ein aufgespannter Schirm.
Die eigentlichen Blüten, bestehend aus jeweils 5 Blütenblättern, sitzen wiederum dicht an dicht an den Döldchen. Viele Döldchen gemeinsam bilden einen flachen Blütenteller, um Fliegen und Käfer zur Landung und damit zur Bestäubung zu animieren.
Die Früchte der Doldenblütler sind Spaltfrüchte, die bei Samenreife in zwei Teile zerfallen. Schaut euch Anis, Kümmel oder Fenchel in eurem Gewürzregal an. Die könnt ihr zudem schon am Aussehen und Geruch unterscheiden.
Die Blätter der Doldenblütler sind gefiedert, sie bilden kein großflächiges Einzelblatt, sondern sind in mehrere Blattabschnitte unterteilt. Doch auch hier gibt es Unterschiede: Die Blätter des Giersch zum Beispiel sind weniger oft unterteilt beziehungsweise gefiedert als die Blätter der Wilden Möhre.
Essbare Doldenblütler
Wilde Möhre
Als Einsteigermodell in Sachen Doldenblütler macht uns die Wilde Möhre (Daucus carota) ihre Bestimmung leicht. Sie wächst üppig auf Wiesen, Brach- und Ruderalflächen. Jede ihrer Blütendolden ist mit filigranen Blättern, sogenannten Hüllblättern umrahmt. Genauso wird auch jedes Döldchen von Hüllblättchen eingefasst. In der Mitte ihrer Dolde sitzt eine schwarze Lockblüte, die ein Insekt vorgaukelt, um Insekten, Schwebfliegen und Käfer anzulocken.
Ein Griff nach dem 30 bis 90 Zentimeter hohen Blütenstängel und ihr spürt, wie borstig-behaart er ist. Die zwei- bis vierfach gefiedert Blätter sehen Karottenkraut zum Verwechseln ähnlich und sobald ihr daran reibt und riecht, wird dieser Eindruck bestätigt. Sehr auffallend sind die Fruchtstände mit den stachelig behaarten Klettfrüchten, die sich wie zu einem Nest zusammenziehen.



Die Wilde Möhre ist eine zweijährige Wildpflanze, die im ersten Jahr nur ihre Blattrosette entwickelt, um Nährstoffe in ihrer Wurzel zu speichern. Gerade dann lohnt sich ein beherzter Griff nach der Wurzel. Wer sie aus dem Boden zieht, hat eine weiße, karottenähnliche Wurzelrübe in der Hand. Daran gerieben, verbreitet sich ebenfalls ein süßlich-würziger, an Karotten erinnernder Geruch. Die gefiederten Blätter der Wilden Möhre könnt ihr in kleinen Mengen als Würzkraut für Salate, Kräuterbutter oder Kräuterquark verwenden. Die Blüten kommen als essbare Dekoration auf Salaten, kalten Platten und in Getränken zum Einsatz oder werden wie Holunderblüten im Backteig ausgebacken. Mit ihren pikant schmeckenden Wurzeln könnt ihr Eintöpfe und Suppen verfeinern. Die Früchte könnt ihr frisch oder getrocknet als Gewürz verwenden, indem ihr die Fruchtstände abrebelt, mörsert oder mit einer Pfeffermühle mahlt. Sie eignen sich auch zur Keimsaat im Winter auf dem Fensterbrett.
Giersch
Mit dem Giersch (Aegopodium podagraria) kommen die meisten bei der Bestimmung ohne die zarten Blütenstände sehr gut klar. Gierschblätter haben dreieckige Blattstiele und dreizählige Blätter, bei denen die seitlichen Fiederblättchen teils nicht ganz getrennt sind. Ein plattgedrücktes Giersch-Blatt bildet einen fast perfekten Halbkreis und wenn ihr es dann noch zerreibt, entwickelt sich ein feiner Petersilienduft. An schattigen Stellen unter Hecken und Sträuchern bildet die nahrhafte Pflanze durch Wurzelausläufer ganze Bestände, was die Ernte sehr leicht macht. Ihre Blätter könnt ihr prima als Petersilienersatz verwenden, als Wildgemüse für eine Quiche, als Pesto, im Salat und zu Spinat oder als Würzkraut zu Kartoffeln, in Kräuterbutter oder Suppen. Lecker schmeckt auch ein Gierschtrunk (siehe Rezept) und nicht zu vergessen: Die Gierschblüten sind als essbare Dekoration ein Augen- und Gaumenschmaus.


Rezept Gierschtrunk
Zutaten: 1 l Sprudel, Wasser oder Apfelsaft, ca. 20 Gierschblätter
Zubereitung: Giersch waschen und mit den Händen gut andrücken. In einem Krug das Getränk mit dem Giersch ansetzen und ziehen lassen.
Tipp: Gundermann, Minze, Melisse und verschiedene Blüten machen sich ebenfalls gut darin. Den Trunk könnt ihr mit Zitronensaft oder Sirup variieren.

Wald-Engelwurz
Die Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris) beschert uns mit ihren halbkugeligen Dolden eine gut sichtbare Unterscheidung zu den sonst flachen Blütentellern der Verwandtschaft. Da sie halbschattige Standorte bevorzugt, findet ihr sie in lichten Wäldern, an Wegrändern und auf feuchten Waldwiesen zusammen mit anderen Hochstauden. Sie erreicht Wuchshöhen von bis zu 150 Zentimeter und sticht schon von weitem ins Auge. Ihre Stängel sind fein gerieft und rötlich verfärbt. Dreht beim Botanisieren auch mal ein Blatt um. Angelika, wie sie auch genannt wird, hat an jeder Blattachse einen roten Ring. Die jungen Blätter könnt ihr ab Mai für Salate, als Gemüse oder Spinat verwenden. Die grünen Früchte eignen sich für Tee, in Likören und Kräuterbittern oder als Gewürz in Gebäck und zu Fleisch und Fisch. Vielleicht habt ihr auch schon mal kandierte Engelwurz probiert. Diese außergewöhnliche Nascherei wird aus den Stängeln der Engelwurz hergestellt und ist in Frankreich sehr beliebt.


Wiesenkerbel
Der Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris), ein Nährstoffzeiger, der auf Wiesen und an Waldrändern häufig vorkommt, macht es uns mit der Bestimmung dagegen nicht leicht. Allein an seinen mehrfach gefiederten Blättern ist es schwierig, ihn von ähnlichen, auch ungenießbaren Artgenossen zu unterscheiden. Ein gutes Erkennungsmerkmal ist sein Blütenstängel, der hohl und ohne Flecken ist und der mit seinen Kerben an eine griechische Säule erinnert. Für die Spezialisten sei noch auf die Hüllblättchen und die geschnäbelten Früchte hingewiesen. Wiesenkerbel schmeckt nach Anis, Karotte und Kümmel. Seine Blätter, Blüten und Früchte werden als Würzkraut für Suppen, Kräuterbutter, Rührei, zu Eingelegtem und zu Gemüse-, Reis- und Kartoffelgerichten verwendet.

Wiesen-Bärenklau
Da macht es uns der Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) leichter. Schon allein an seinen groben, lappig zerteilten und behaarten Grundblättern, die an Bärentatzen erinnern, erkennen ihn die meisten. Dazu kommt sein kantiger, rauer Blütenstängel und seine knospigen Blütenstände, die in bauchigen Blattscheiden am Stängel sitzen. Er kommt bis ins Flachland auf nährstoffreichen Wiesen üppig vor. Sein Geschmack erinnert an Sellerie und Fenchel und seine ungeöffneten Blütenstände sehen wie kleine Brokkoli-Röschen (siehe Rezept) aus und können genauso verwendet werden. Die geöffneten weißen Blütenteller kommen als essbare Dekoration in Salaten oder auf grünen Nudeln gut zur Geltung.

Rezept Wiesenbrokkoli
Zutaten: 4 bis 6 halbgeöffnete Blütenstände pro Person. Dabei von einer Pflanze immer nur 2 bis 3 Blütenstände ernten, damit die Pflanze noch genügend Blüten ausbilden kann, 1 Zwiebel, etwas Butter, Kräutersalz, Pfeffer.
Zubereitung: Die Blütenstände in etwas Salzwasser ca. 3 Minuten dämpfen. Die kleingeschnittene Zwiebel in der Butter andünsten und den „Wiesenbrokkoli“ darin schwenken. Je nach Geschmack würzen und zum Beispiel über Nudeln servieren.

Viel Freude am Botanisieren wünscht euch Monika Wurft!
Mehr Kräuterwissen gibt’s im Buch von Monika Wurft:
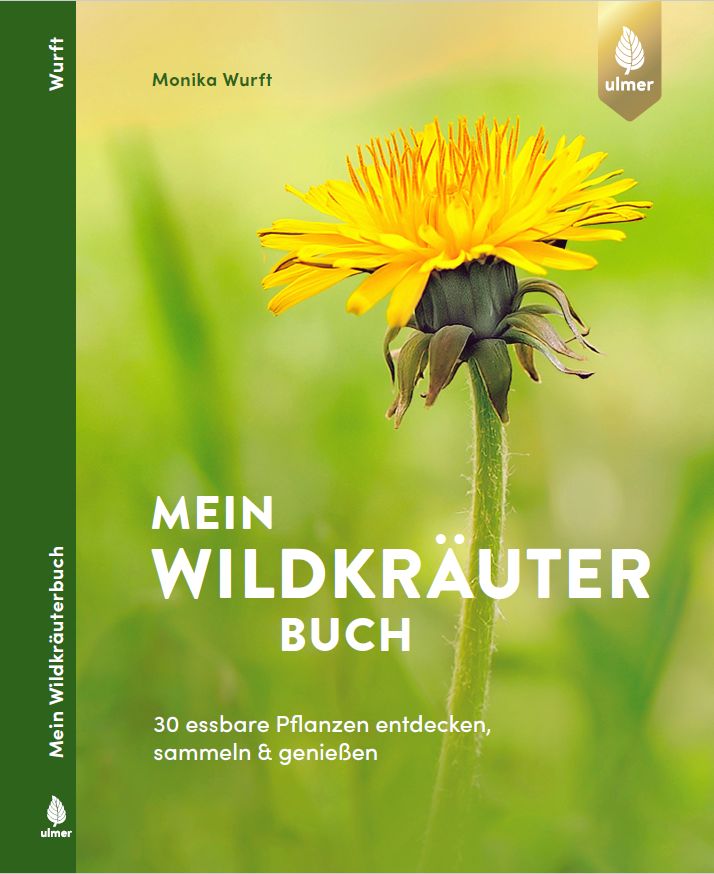


Monika Wurft, Mein Wildkräuterbuch, 2. Auflage März 2020 Ulmer-ISBN: 978-3-8186-1123-1
(Text und Fotos: Monika Wurft)
27.4.2023









 Jetzt Shoppen!
Jetzt Shoppen!