Heute schauen wir mit unserer Kräuterfrau und Schwarzwald-Guide Monika Wurft ein Allerwelts-Kraut an, das meist erst zur Blütezeit ins Auge sticht, obwohl es lange davor schon interessant ist: den Löwenzahn. Nachdem wir uns mit typischen Winterkräutern wie Gartenschamkraut und Vogelmiere die kalte Jahreszeit auf unserem Teller begrünt haben, gibt es ab sofort wieder neues, frisches Grün zu ernten.
Wenn ihr zurzeit die ersten frischen Bitterkräuter sucht, dann seid ihr beim Löwenzahn genau richtig. Denn zurzeit lugen die feinen, kleinen Rosetten überall knackig frisch hervor. Sie drücken sich zwar noch wärmesuchend an den Boden und sind bei tiefen Temperaturen rötlich gefärbt, doch das tut keinen Abbruch. Erntezeit ist jetzt!


Überall wächst dieser frische, knackige „Salat“
Mit seinen zarten Rosetten und den gezackten Blättern ist der Löwenzahn den meisten bekannt und ihr werdet ihn in jedem Garten und auf jeder Wiese üppig finden. Allerdings sind Löwenzahnblätter sehr vielgestaltig und abhängig vom Lichteinfluss mal extrem gezackt, mal beinahe ganzrandig. Davon dürft ihr euch nicht irritieren lassen. Auch die Rotfärbung der Blätter nach Minusgraden ist kein Erntehindernis. Es handelt sich bei diesen Anthozyanen um Pflanzenfarbstoffe, die der Pflanze als Kälteschutz dienen.

Die Blütezeit des Löwenzahns beginnt je nach Höhenlage im April und dauert bis in den Mai hinein. Seine leuchtend goldgelben Blüten sitzen auf einem hohlen, blattlosen Stängel, der Milchsaft führt. Beim genaueren Hinschauen werdet ihr feststellen, dass es sich dabei um unzählige Einzelblüten handelt, die in einem Körbchen zusammensitzen. Denn jedes gelbe „Blütenblatt“ ist in Wahrheit eine Blüte, eine sogenannte Zungenblüte mit jeweils fünf Staubgefäßen. Der Pollen der einzelnen Blüten bleibt er an den Bauchhaaren von Bienen haften und wird so zum benachbarten Blütenkörbchen transportiert.


Löwenzahn gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und ist verwandt mit vielen Gartenlieblingen wie Sonnenblumen, Ringelblumen, Astern und Gänseblümchen.
Pusteblume und Pfahlwurzel
Löwenzähne werden durch diese Vielzahl der Blüten zu wahren Überlebenskünstlern. Jede einzelne Zungenblüte wird zum Samenkorn mit einem eigenen Flugschirm, dem so genannten Pappus. Wo der Wind ihn hinträgt wächst ein neuer Löwenzahn. Am üppigsten auf fruchtbaren Böden und nährstoffreichen Wiesen und Weiden. Außerdem ist der Löwenzahn mit einer kräftigen Pfahlwurzel tief im Boden verankert. Sie kann bis zu einem Meter lang werden und sichert ihm so seinen festen Platz in der Wiese.


Löwenzahn hat´s in sich
Botanisch heißt er Taraxacum officinale- „bitteres Kraut“- und ist eine alte und überaus geschätzte Heilpflanze. Auch als Kuhblume, Bitterblume, Bettseicher oder Butterblume bekannt, liegt seine Hauptwirkung im Magen- Darmbereich. Seine Bitterstoffe, kombiniert mit Gerbstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, regen die Verdauung, die Nierentätigkeit und die Produktion von Gallensaft an. So kommt die Heilpflanze in der Volksheilkunde unter
anderem bei Verstopfung, Völlegefühl und Blähungen, bei Appetitlosigkeit und bei Harnwegsinfekten in Form von Tee, Tinktur und frischem Presssaft zum Einsatz. Bitterstoffpflanzen wie der Löwenzahn unterstützen die Blutbildung, stimulieren das Immunsystem und tonisieren Körper und Seele. Löwenzahn wird durch die Bitterstoffe auch zum Fatburner. Er kurbelt die Fettverdauung an und aktiviert, als wirkungsvolle Essbremse, das Sättigungsgefühl.
Kulinarisch-vielseitig und lecker
So jung und zart wie zurzeit schmecken die Blättchen des Löwenzahns besonders lecker und ihr könnt sie als reinen Löwenzahnsalat, als Zugabe zu Blattsalaten, im Kartoffelsalat oder im Kräuterquark verwenden. Aber das ist längst nicht alles. Am Löwenzahn ist alles essbar…außer der Pusteblume! Achtet in der nächsten Zeit unbedingt auf seine knackigen Knospen. Sie ballen sich in der Mitte seiner Rosetten zusammen und lassen sich mit dem Fingernagel leicht ausknipsen. Sie werden in Öl gebraten und mit etwas Kräutersalz abgeschmeckt zum idealen Wildgemüse zum Beispiel über Nudeln.

Danach sind die gelben Blüten dran. Als essbare Dekoration, in Kräuterbutter oder über Salate gestreut verwandeln sie jedes Gericht in einen Augenschmaus. Selbst seine kräftigen Pfahlwurzeln könnt ihr als Gemüse zubereiten, oder ihr setzt einen Magenbitter damit an. Geröstete und gemahlene Löwenzahnwurzeln ergeben zudem einen bekömmlichen Kaffeeersatz.
Löwenzahn-Rezepte
Löwenzahnsalat
Zutaten
- 3 Handvoll Löwenzahnblätter
- 30 g Speckwürfel
- 1 Zwiebel
Für die Salatsoße
- 4 EL Öl
- 2 EL Essig
- 1 EL Senf
- Salz, Pfeffer
- etwas Creme fraîche
- 1 mittelgroße gekochte Kartoffel
Zubereitung
Die gewaschenen und trocken geschleuderten Löwenzahnblätter in mundgerechte Stücke teilen. Den Speck in einer Pfanne auslassen und die gewürfelte Zwiebel kurz dazugeben. Für die Salatsoße alle Zutaten miteinander vermischen und die gekochte Kartoffel mit einer Gabel zerdrückt unterrühren. Schließlich den Löwenzahn unter die Salatsoße heben und Speck und Zwiebeln darüber verteilen.
Mein Tipp: Für die vegetarische Variante könnt ihr statt Speck ein in Würfel geschnittenes hartes Ei unterheben.

Löwenzahnkaffee
Stecht einfach einige Löwenzahnpflanzen mitsamt der Wurzel aus und schrubbt diese gründlich ab. Dann schneidet ihr die Wurzeln klein und röstet diese Wurzelstücke in einer Pfanne oder im Backofen bis sich diese kaffeebraun verfärbt haben und einen typischen Röstgeruch verströmen. Nach dem Abkühlen könnt ihr die gerösteten Wurzelstücke in einer Kaffeemühle fein mahlen. Ein Teelöffel dieses Pulvers reicht für eine Tasse Kaffee. Diesen brüht ihr genau wie Bohnenkaffee auf.
Mein Tipp: Wer nun den typischen Kaffeegeschmack erwartet, wird allerdings enttäuscht sein. Denn sein bitterherber Geschmack ist zwar lecker, aber für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig. Um in den Vorteil der Bitterstoffe zu kommen und gleichzeitig den typischen Kaffeegeschmack zu genießen, macht einfach halbe-halbe.
Viel Freude und guten Appetit mit dem vielseitigen Löwenzahn!
Mehr Kräuterwissen gibt’s im Buch von Monika Wurft:
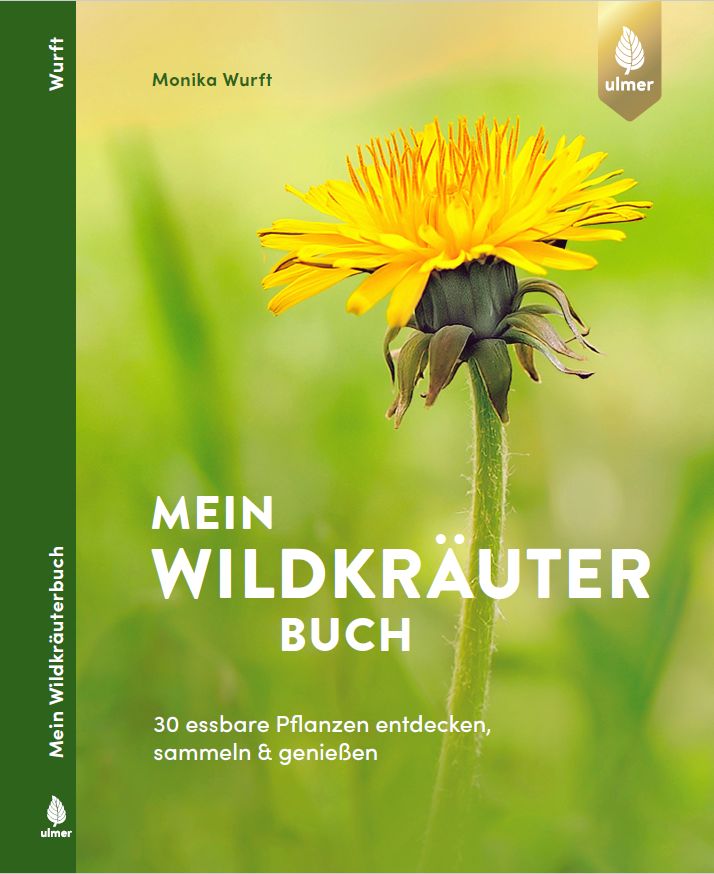


Monika Wurft, Mein Wildkräuterbuch, 2. Auflage März 2020 Ulmer-ISBN: 978-3-8186-1123-1
(Text und Fotos: Monika Wurft)
1.3.2022








