Heute schauen wir uns mit unserer Kräuterfrau und Schwarzwald-Guide Monika Wurft den genialen Kleinen Wiesenknopf näher an. Er trotzt der Hitze, verträgt einen kräftigen Rückschnitt, treibt danach neu aus und lässt sich als Gurkenersatz verwenden.
Der Kleine Wiesenknopf, Sanguisorba minor, machte von Mai bis in den September seinem Namen alle Ehre. Während seiner Blütezeit erkennt ihr ihn schon von Weitem, denn dann lugt er, übersät mit unzähligen roten Blütenk(n)öpfchen, aus der Wiese heraus. Wenn ihr einen Garten euer Eigen nennt, könnt ihr, die auch als „Blutströpfchen“ bezeichnete, ausdauernde Wildpflanze dort ansiedeln. Sie ist eine Zierde für jeden Garten und ihr könnt euch an den kleinen Blättchen in der Kräuterküche und ganz besonders als Gurkenersatz in einem Tsatsiki erfreuen.


Das Aha-Erlebnis „Diese Pflanze kenne ich“ erlebe ich bei Kräuterführungen allerdings erst, wenn die Bezeichnung Pimpinelle fällt. Den Namen Wiesenknopf kennen die Wenigsten. Zu verdanken ist das ist der berühmten Frankfurter Grünen Soße, bei der unter anderem Pimpinelle verwendet wird. Dass damit niemand anderes als der Kleine Wiesenknopf gemeint ist, hängt mit der Ähnlichkeit seiner Blättchen mit den Blättchen der Bibernelle zusammen, die botanisch Pimpinella saxifraga heißt. Höchstwahrscheinlich wurde der Kleine Wiesenknopf deshalb im Küchenjargon einfach zur Pimpinelle ernannt. Die Tatsache, dass die Bibernelle nicht zu den Rosengewächsen, sondern zu den Doldenblütlern gehört, tat der
Namensvergabe keinen Abbruch.
Daran erkennt ihr den Kleinen Wiesenknopf
Das weit verbreitete Wildkraut gehört zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae), wächst auf wenig gedüngten Wiesen, an Wegrainen und in Trockenrasen und wird zwischen 30 und 60 Zentimeter hoch. Seine Grundblätter wachsen in einer Rosette, aus deren Mitte sich ein aufrechter, wenig verzweigter Stängel emporreckt. Jedes seiner Blätter setzt sich aus vier bis sieben gezähnten Blattpaaren und einem gleichgroßen Endblättchen zusammen.



Eindeutig zu erkennen ist der Wiesenknopf zur Blütezeit an seinen markanten ein bis zwei Zentimeter großen, roten Blütenköpfchen. Diese setzen sich aus zahlreichen, dicht an dicht stehenden Einzelblüten zusammen. Interessant ist dabei, dass sich die Blüten in den Köpfchen voneinander unterscheiden, ja sogar zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Ganz oben präsentieren sich die weiblichen Blüten, dazwischen zwittrige und unten männliche Blüten.
Als Ausnahme unter den Rosengewächsen wird der Kleine Wiesenknopf vorwiegend vom Wind bestäubt. Durch die unterschiedlichen Blütezeiten wird die Fremdbestäubung gefördert. Der Gattungsname der Pflanze „Sanguisorba“ leitet sich von „sanguis“ für Blut und „sorbere“ für aufsaugen ab. Er liefert einen Hinweis auf die heilkundliche Verwendung des Wiesenknopfs bei Wunden. Der Artname „minor“, im Sinne von klein, unterscheidet ihn von dem wesentlich größeren und bittereren Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), der Blume des Jahres 2021 war. Beide Wildkräuter können sowohl als Heilpflanze wie auch als Küchenkraut verwendet werden.


Der Kleine Wiesenknopf hat´s in sich
In der Volksheilkunde wird der Wiesenknopf wegen seiner Gerbstoffe, Flavonoide und Saponine innerlich bei Verdauungsbeschwerden und als harntreibendes und Appetit anregendes Mittel verwendet. Äußerlich kann er zur Wundheilung, bei Verbrennungen, Sonnenbrand und zum Gurgeln bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum eingesetzt werden. Als Vitamin-C-Lieferant stärkt er das Immunsystem und ist hilfreich bei Frühjahrsmüdigkeit.
Zur Teeherstellung könnt ihr ein bis zwei Teelöffel frische, kleingeschnittene Blätter mit einem Viertelliter kochendem Wasser übergießen, zehn Minuten ziehen lassen und zwei Tassen täglich trinken. Äußerlich könnt ihr diesen Teeauszug als Wundauflage in Form eines Umschlags oder zum Gurgeln einsetzen.
Ernte beim Kleinen Wiesenknopf
Die klassische Erntezeit des Kleinen Wiesenknopfs beginnt schon im Februar, also denkt gleich mal ans kommende Frühjahr! Seine jungen, noch leicht eingerollten Blättchen schmecken dann besonders gut. Probiert ihn einfach mal von der Pflanze ab in den Mund. Ihr werdet feststellen, dass die Blättchen beim Zerkauen ein kräftiges, gurkenähnliches Aroma entwickeln und vermutlich deshalb ein fester Bestandteil der Grünen Soße sind.

Das beliebte Küchenkraut könnt ihr jedoch auch als Brotbelag, Salatbeigabe, in Smoothies, zu Kartoffelsalat, Eierspeisen, in Kräuterbutter, Tsatsiki und für Wildkräutersuppen verwenden. Die knospigen Blütenstände, im Geschmack herber, könnt ihr in Fruchtsaft, Essig oder Öl eingelegen oder als essbare Dekoration nutzen.
Natur- und Gartentipp
Der attraktive Kleine Wiesenknopf mit seinen zarten Blättchen und den roten Blütenköpfchen sollte in keinem Kräutergarten fehlen. Für Kinder sind seine auch als „Blutströpfchen“ bezeichneten Blüten eine beliebte Spielpflanze. Im Garten stellt er sich oft von selbst ein, ist pflegeleicht und verbreitet sich munter weiter.

Die Aussaat erfolgt im März bis April direkt ins Freiland an einen sonnigen Standort. Im Laufe des Sommers werden seine Blättchen zäh. Dann kommt ein kräftiger Rückschnitt der gesamten Pflanze einer verlängerten Erntezeit zugute. Danach treibt der kleine Wiesenknopf sofort wieder frisch aus und ihr könnt bis weit in den Herbst hinein knackige Blättchen wie im Frühling ernten. Die Trockenheit im diesjährigen Sommer hat er übrigens unbeschadet und ohne zusätzliches Gießen überstanden. In milden Wintern bleiben die Blätter des Kleinen Wiesenknopf zudem grün und können beinahe ganzjährig
verwendet werden. Zwei zusätzliche Pluspunkte für den Anbau im eigenen Garten.
Rezept
Nun steht einem Wiesenknopf-Tsatsiki nichts mehr im Wege. Doch halt, keine Gurke im Haus? Kein Problem! Den gurkigen Geschmack, in Tsatsiki ganz wichtig, erreicht ihr durch den Kleinen Wiesenknopf. Also los geht’s!

Zutaten:
- 2-3 Handvoll Wildkräuter: Kleiner Wiesenknopf, aber auch Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere, Spitzwegerich, Sauerampfer und Schafgarbe.
- Die Kräuter waschen, verlesen und fein hacken.
- 1 Knoblauchzehe gequetscht
- 200 g Quark oder Topfen
- 150 g Joghurt,
- 200 g zerdrückter Fetakäse
- etwas Olivenöl, Kräutersalz, Pfeffer.
Zubereitung
Den Quark rührt ihr mit Joghurt, Feta, Knoblauchzehe und dem Olivenöl cremig. Dann hebt ihr die fein gehackten Kräuter unter und würzt den Tsatsiki mit den Gewürzen kräftig ab. Zum Dekorieren könnt ihr Gänseblümchen, Königskerzen- und Nachtkerzenblüten verwenden oder blaue Blüten von Borretsch und Natternkopf. Dazu passen Weißbrot oder Pellkartoffel!
Tipp: Ohne Feta, dafür mit einem gehackten harten Ei, einer klein geschnittenen Zwiebel, saurer Sahne oder etwas Frischkäse, sowie Gartenkräutern wie Petersilie und Schnittlauch könnt ihr daraus eine Grüne Soße entwickeln. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Viel Spaß mit dem Kleinen Wiesenknopf und guten Appetit!
Mehr Kräuterwissen gibt’s im Buch von Monika Wurft:
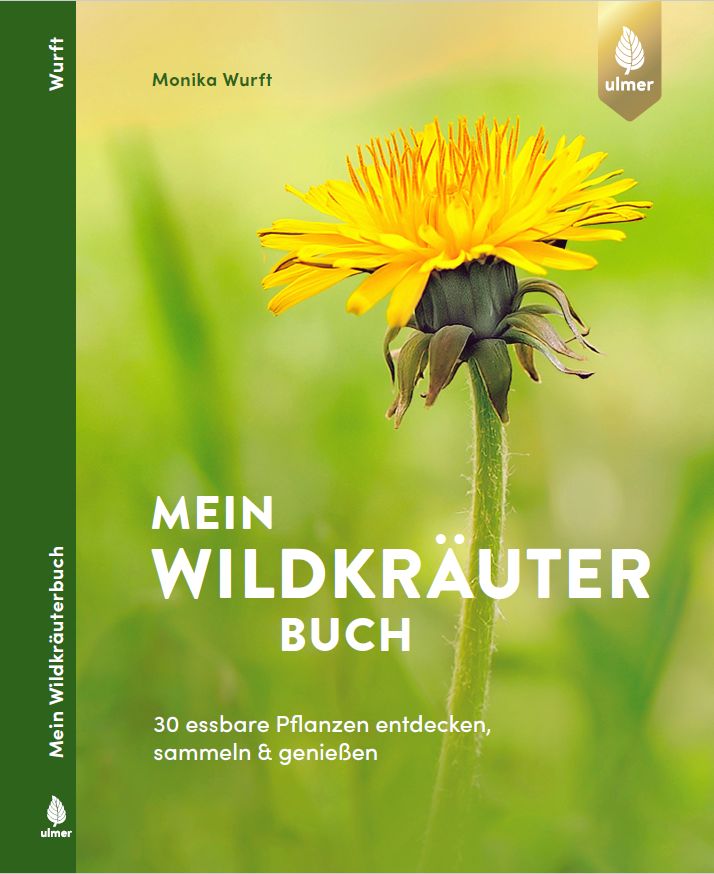


Monika Wurft, Mein Wildkräuterbuch, 2. Auflage März 2020 Ulmer-ISBN: 978-3-8186-1123-1
(Text und Fotos: Monika Wurft)
22.9.2022









 Jetzt Shoppen!
Jetzt Shoppen!